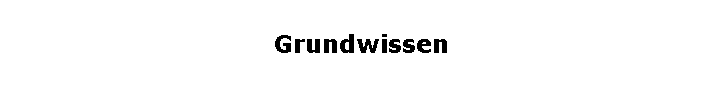
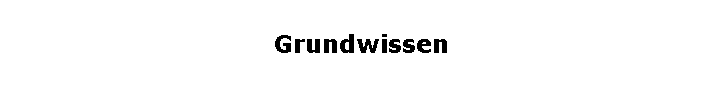 |
|
|
|
Deutsch-Grundwissen für die Jahrgangsstufe 5 Deutsch-Grundwissen für die Jahrgangsstufe 6 Deutsch-Grundwissen für die Jahrgangsstufe 7 |
||||||||||||||
|
Deutsch-Grundwissen für die Jahrgangsstufe 5
I. Sprechen und Schreiben1. Gesprächsregeln bei Entscheidungsfindungen und Konflikten
2. Schreiben von Briefen persönlichen und sachlichen Inhalts
3. Erzählen 3.1 Erlebniserzählung
3.2 Fantasieerzählung
3.3 Bildergeschichte Zu beachten ist hier zusätzlich zu den in 3.1 und 3.2 genannten Kriterien:
3.4 Reizwortgeschichte
4. Berichten
II. Nachdenken über Sprache1. Wortarten
1.1 Nomen Sie kommen vor als Konkreta und Abstrakta. Flexion der Nomen nach:
1.2 Artikel Sie sind bestimmt oder unbestimmt. 1.3 Adjektive
1.4 Numeralia (Sg.: das Numerale) Sie werden meist zu den Adjektiven gezählt. Unterscheidung nach:
1.5 Pronomen (Fürwörter)
1.6 Präpositionen (Verhältniswörter) Sie bezeichnen:
1.7 Verben (Zeitwörter)
1.8 Konjunktionen
1.9 Adverbien (Umstandswörter, Sg.: das Adverb) Unterscheidung nach:
2. Wortbildung 2.1 Ableitungen Verschiedene Wortbausteine:
2.2 Zusammensetzungen
2.3 Wortfamilien
3. Wort und Bedeutung 3.1 Wortfeld
3.2 Mehrdeutige Wörter (Homonyme)
4. Satzarten
5. Satzglieder
Bestimmen der Objekte:
Weitere Satzglieder sind adverbiale Bestimmungen (Adverbialien):
6. Satzgefüge ... bestehen aus Haupt- und Nebensätzen. Nebensätze sind erkennbar an:
7. Wichtige Regeln für die Zeichensetzung Wichtige Satzschlusszeichen: Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen Das Komma steht zwischen:
Die Zeichensetzung bei der wörtlichen Rede:
8. Rechtschreibung Tipps zur Anwendung in Zweifelsfällen:
Hilfen:
Laute und Buchstaben:
Regeln für...
III. Umgang mit Texten und Medien1. Erzählende Literatur 1.1 MärchenKennzeichen von Volksmärchen:
1.2 Lügengeschichte
1.3 Schelmengeschichte 1.4 Sage
1.5 Legende Geschichte über das Leben und Wirken von Heiligen 1.6 Fabel
2. Gedichte
3. Fernsehen Fachbegriffe aus diesem Medienbereich:
4. Theater
|
||||||||||||||
|
Deutsch-Grundwissen für die Jahrgangsstufe 6 Bei Lerninhalten, die im Vorjahr als Grundwissen aufgenommen wurde, wird nur darauf verwiesen.
I. Mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch 1. Gesprächsregeln Sie sollen eingehalten werden, um die Verständigung zu erleichtern.
2. Berichten Die sechs W-Fragen:
Sachstil; Zeitform: Präteritum
3. Beschreiben 3.1 Wegbeschreibung
3.2 Vorgangsbeschreibung
3.3 Gegenstandsbeschreibung
4. Der sachliche Brief
5. Erzählen
II. Nachdenken über Sprache 1. Wortarten 1.1 Das Nomen (Substantiv, Hauptwort) deklinierbar: siehe 5. Klasse 1.2 Der Artikel deklinierbar:
1.3 Adjektive
1.4 Numeralia (Zahlwörter, Sg.: das Numerale) deklinierbar: siehe 5. Klasse 1.5 Pronomen (Fürwörter, Pl.: Pronomina) deklinierbar je nach Pronomenart:
1.6 Präpositionen (Verhältniswörter) nicht deklinierbar; Bezeichnung von...
1.7 Adverbien
1.8 Verben (Zeitwörter)
Die Tempora (die Zeiten):
Aktiv (Handlungsverb) und Passiv (werden + Partizip II) in allen Tempora: z.B. sie sucht / sie wird gesucht 1.9 Konjunktionen (Bindewörter) Nicht deklinierbar.
Es geht fast immer ein Komma voraus.
2. Wortbildung siehe 5. Klasse
3. Wort und Bedeutung
4. Satzglieder Ermittlung durch Umstellprobe bzw. Satzgliedfrage
Adverbiale Bestimmungen:
5. Der zusammengesetzte Satz
Unterscheidung verschiedener Gliedsätze:
Zeichensetzung: Komma steht in folgenden Fällen:
Die Regeln für die Zeichensetzung der wörtlichen Rede: vgl. 5. Klasse
6. Rechtschreiben Hilfen:
Ausprobieren von Schreibweisen:
Silbentrennung:
Fremdwörter: Suffixe als Erkennungsmerkmal (-ieren, -iv, -tion, - tät) Doppelkonsonanten: nach betontem kurzem Vokal Verdoppelung oder Häufung von Konsonanten Lang gesprochene Vokale a,e,i,o,u oder Umlaute ä,ö.ü können mit einfachem Buchstaben geschrieben werden oder mit Dehnungs-h: oft vor l,m,n,r (vgl. Buch) langes i: meist als ie geschrieben, außer bei den Pronomina (ihr, ihm), in Fremdwörtern oft nur i geschrieben s-Laute:
Wechsel von ss und ß in manchen Verbformen Vorsilbe:
das oder dass:
Groß- und Kleinschreibung:
III. Umgehen mit Texten und Medien 1. Erzählende Literatur (= Epik) Ein vom Autor erfundener Erzähler berichtet über ein Geschehen.
1.1 Märchen (Volksmärchen) Kennzeichen: vgl. 5. Klasse 1.2 Fabel Kennzeichen: vgl. 5. Klasse 1.3 Sage Unterscheidung nach Volks- und Heldensage: vgl. 5. Klasse 1.4 Legende Kennzeichen: vgl. 5. Klasse 1.5 Epos
2. Gedichte
3. Sachtexte
4. Theater
5. Film / Fernsehen
6. Hörspiel Vertonung von Texten
7. Arbeitstechniken und Methoden Erschließung von Texten:
Umgang mit dem PC: Schreiben und Überarbeiten von Texten
|
||||||||||||||
|
Deutsch-Grundwissen für die Jahrgangsstufe 7 Bei den Lerninhalten, die in den Vorjahren als Grundwissen aufgenommen wurden, wird nur darauf verwiesen.
I. Sprechen und Schreiben 1. Gesprächsregeln vgl. Klasse 5
2. Berichten vgl. Klasse 5 und 6
3. Beschreiben vgl. Klasse 6 für Vorgangs- und Gegenstandsbeschreibung; neu: Bildbeschreibung und Personenbeschreibung 3.1 Bildbeschreibung wesentlich: Bildinhalt, Farben und Formen (als Stimmungsträger) Aufbau: Einleitung, Hauptteil, Schluss Hauptteil:
Schluss: Gesamteindruck, Wirkung auf den Leser Sprache:
3.2 Personenbeschreibung
4. Argumentieren 4.1 Aufbau einer Argumentation
4.2 Die begründete Stellungnahme als Leserbrief Schreibanlass bezogen auf einen Zeitungsartikel Aufbau:
Sprachliche Gestaltung:
5. Der sachliche Brief vgl. Klasse 6
6. Texte zusammenfassen Wichtige Kriterien: Absicht: Kurze und sachliche Information über...
Inhalt:
Aufbau:
Sprache und Stil:
7. Gestalterisches Schreiben: Verfassen schildernder Passagen 7.1 Wiedergabe der inneren Handlung
7.2 Erzählerische und sprachliche Mittel
II. Nachdenken über Sprachevgl. Klasse 5 und 6 in allen Punkten Voraussetzung: Wortarten, Deklination, Konjugation, Syntax, Satzglieder
1. Der Modus: Indikativ und Konjunktiv ... als zwei Aussagearten des Verbs:
1.1 Indikativ
1.2 Konjunktiv II: für Mögliches, Unwahrscheinliches, Wünschenswertes Dies wird - wenn möglich - im Konjunktiv II ausgedrückt. (z.B. Hätte ich ein Auto, führe ich zur Meisterschaft.) Bildung des Konjunktiv II:
Umschreibung mit „würde“ bei fehlenden Unterschneidungsmöglichkeiten (1) oder bei ungewöhnlichen Formen (2) Bildung der würde-Form:
1.3 Konjunktiv I: Verwendung in der indirekten Rede Beispiel: „Er sagte, er sei gestern krank gewesen.“ Fehlende Unterscheidung von Indikativ und Konjunktiv I: In diesem Fall kann man Konjunktiv II oder die Umschreibung mit „würde“ wählen.
2. Wort und Bedeutung 2.1 Wortfamilien vgl. Klasse 5 und 6 2.2 Bedeutungswandel von Wörtern
3. Satzglieder vgl. Klasse 5 und 6 Attribute als Satzgliedteile
Formen des Attributs:
4. Nebensätze 1. Adverbialsätze vgl. Klasse 6 2. Subjekt- und Objektsätze
2. Relativsätze vgl. Klasse 6
5. Kommaregeln vgl. Klasse 5 und 6, neu: Infinitiv- und Partizipialsätze 3.1 Infinitivsätze a) Sie werden normalerweise nicht durch ein Komma vom übergeordneten Satz abgetrennt. Zur besseren Gliederung und Verständlichkeit kann aber ein Komma gesetzt werden. b) Ein Komma muss stehen, wenn durch ein hinweisendes Wort auf den Infinitivsatz Bezug genommen wird. Hinweisende Wörter: es, damit, daran, darauf, dazu („Er vermied es, ihn anzuschauen.“) 3.2 Partizipialsätze a) Regel wie 3.1 a) b) Ein Komma muss stehen bei
III. Rechtschreibungvgl. Klasse 5 und Klasse 6; genaues Eingehen auf:
1. Groß- und Kleinschreibung 1.1 Nominalisierungen aufgrund von Signalwörtern
1.2 Nominalisierung von Zahlwörtern
1.3 Schreibung von Zeitangaben ... aufgrund von Signalwörtern 1.4 Eigennamen 1.5 Herkunftsbezeichnung
2. Getrennt- und Zusammenschreibung 2.1 Wortgruppen aus Nomen und Verb 2.2 Wortgruppen aus Verb und Verb 2.3 Wortgruppen aus Adjektiv und Verb Dies betrifft Adjektive mit der Endung -ig, -lich und -isch. 2.4 Verbindung aus Adjektiv und Verb
IV. Umgehen mit Texten und Medien1. Erzählende Literatur
1.1 Das höfische Epos
1.2 Die Sage vgl. Klasse 5 und 6 1.3 Die Anekdote
1.4 Die Kurzgeschichte ... als Form der modernen Erzählung mit folgenden, wesentlichen Kennzeichen:
2. Gedichte Vertiefung und Erweiterung der in Klasse 5 und 6 eingeführten Fachbegriffe:
Sonderform: Die Ballade (Verknüpfung von epischen, lyrischen und dramatischen Elementen)
3. Sachtexte a) Funktion und Gestaltungsmerkmale b) Aufbau und graphische Gestaltung (äußere Form)
4. Drama / Theater Vervollständigung und Vertiefung wichtiger Fachbegriffe, die in Klasse 5 und 6 eingeführt wurden, wie z.B.:
5. Film / Fernsehen
V. Arbeitsschritte und Methoden1. Die 5-Schritt-Lesemethode 2. Diagrammauswertung 3. Informationsrecherche 4. Halten eines Kurzreferats 5. Schreibkonferenz 6. Texte am PC überarbeiten
|
||||||||||||||
|
Deutsch-Grundwissen für die Jahrgangsstufe 8
I. Sprechen und Schreiben 1. Miteinander sprechen 1.1 Gesprächsregeln vgl. Klasse 5 ff; Ergänzung: Einarbeitung in die Rolle des/der Gesprächsleiters/-in:
1.2 Diskutieren
2. Der Bericht vgl. Klasse 5 und 6 3. Der sachliche Brief vgl. Klasse 5 und 6 4. Schreiben von Inhaltsangaben 4.1 Inhaltsangabe eines Sachtextes Funktion: kurze und sachliche Information über den Inhalt und Gedankengang eines Textes Aufbau: informierende Einleitung nach den W-Fragen sowie Thema und Kernaussage des Textes (Basissatz) Hauptteil: Inhalt und Gedankengang des Textes mit eigenen Worten (außer Fachbegriffe) Stil und Sprache:
4.2 Inhaltsangabe eines literarischen Textes Kriterien wie bei 4.1
5. Protokolle schreiben 5.1 Verschiedene Protokollarten
Das Tempus ist bei allen Arten das Präsens; Wiedergabe wichtiger Gesprächsbeiträge in der indirekten Rede (Konjunktiv I). 5.2 Form des Protokolls Protokollkopf:
Hauptteil: eigentliche Niederschrift Schluss:
6. Argumentieren und die begründete Stellungnahme 6.1 Argumentieren vgl. dazu die Ausführungen zu Klasse 7 6.2 Die begründete Stellungnahme: Der Leserbrief vgl. Klasse 7
7. Erörtern --> Die freie Erörterung Erörterung als schriftliche Form der Argumentation Argumentationsaufbau:
Aufbau des Aufsatzes:
Schritte zur Erstellung:
Achten auf:
8. Erörtern im Anschluss an einen Text (= textgebundene Erörterung)
II. Nachdenken über Sprache1. Wortarten im Überblick wie in Klasse 5 und 6 2. Wort und Bedeutung 2.1 Wortfamilie wie in Klasse 5 und 6 2.2 Die Zusammensetzung unseres Wortschatzes (neu)a) Erbwörter aus dem Germanischen oder Indogermanischen geerbt b) Aus fremden Sprachen übernommen:
2.3 Bedeutungswandel vgl. Klasse 7
3. Satzglieder vgl. dazu Klasse 5, 6, 7
4. Der zusammengesetzte Satz vgl. dazu Klasse 5, 6, 7
5. Zeichensetzung wie in den genannten Vorjahren
5.1 Das Komma bei Zusätzen und Nachträgen (neu) Abgetrennt durch Komma werden:
5.2 Das Komma bei Ausrufen (neu) 5.3 Das Komma bei mehrteiligen Orts-, Zeit- und Literaturangaben (neu)
6. Die Rechtschreibung vgl. dazu Klasse 5, 6, 7 Besonderes Gewicht auf der Getrennt- und Zusammenschreibung von Wortgruppen:
III. Umgang mit Texten und Medien 1. Erzählende Literatur 1.1 Das höfische Epos vgl. Klasse 7 1.2 Die Anekdote vgl. Klasse 7 1.3 Die Kurzgeschichte vgl. Klasse 7
2. Untersuchung erzählender Texte Untersuchungskriterien:
3. Untersuchung sprachlicher Gestaltungsmittel
4. Lyrik vgl. Klasse 5, 6, 7 Neu sind folgende Aspekte:
4.1 Ballade vgl. Klasse 7 4.2 Das Sonett
5. Drama / Theater vgl. dazu Klasse 5-7 Definition als literarische Großgattung Fachbegriffe:
6. Umgang mit Sachtexten 6.1 Merkmale von Sachtexten vgl. dazu die Ausführungen zu Klasse 7 6.2 Auswertung von Sachtexten nach Arbeitsschritten
7. Medien 7.1 Zeitungen – Zeitungstypen a) Boulevardzeitung (Straßenverkauf) b) Für Abonnenten:
7.2 Journalistische Textsorten a) Die Nachricht:
b) Der Kommentar:
c) Die Glosse:
d) Die Reportage:
e) Das Interview:
7.3 Zeitschriften a) Unterscheidung in Printmedien oder elektronische Medien (Online-Zeitschriften) b) Unterteilung in Publikumszeitschriften und Fachzeitschriften 7.4 Film und Fernsehen Fachbegriffe:
IV. Arbeitstechniken und Methoden 1. Techniken des Mitschreibens
2. Möglichkeiten der Informationsrecherche
3. Informationsmaterial auswerten
4. Diagramme auswerten
5. Texte am PC überarbeiten
6. Schreibkonferenz
7. Texte erschließen vgl. Klasse 7 und „Sachtexte erschließen“
8. Halten von Referaten Einleitung:
Hauptteil:
Schluss:
WICHTIG:
|
||||||||||||||
|
Deutsch-Grundwissen für die Jahrgangsstufe 9 Bei Lerninhalten, die in den Vorjahren als Grundwissen aufgenommen wurden, wird nur darauf verwiesen.
I. Sprechen und Schreiben 1. Diskutieren
2. Sachliche Briefe schreiben siehe Vorjahre
3. Protokolle schreiben siehe 8. Klasse
4. Erörtern 4.1 Steigernde Erörterung
4.2 Antithetische Erörterung
5. Der Leserbrief siehe Vorjahre
6. Erweiterte Inhaltsangaben 6.1 von literarischen Texten
6.2 von Sachtexten siehe literarische Texte 6.3 Textbelege richtig zitieren
II. Nachdenken über Sprache 1. Sprachgeschichte siehe Vorjahr
2. Sprache, Stil und Wortbedeutung 2.1 Sprachvarianten (Sprachvarietäten)
2.2 Verschiedene sprachliche Stilebenen 2.3 Stereotype Formulierungen abgegriffene, verschlissene Bilder und Ausdrucksweisen 2.4 Konnotation Nebenbedeutung eines Wortes
3. Rhetorische Figuren
4. Wortarten siehe Vorjahre
5. Satzglieder siehe Vorjahre
6. Der zusammengesetzte Satz siehe Vorjahre
7. Nebensätze siehe Vorjahr
8. Zeichensetzung siehe Vorjahre
9. Rechtschreibung siehe Vorjahre
III. Umgehen mit Texten und Medien 1. Erzählende Literatur 1.1 Anekdote siehe Vorjahr 1.2 Kurzgeschichte
1.3 Novelle
1.4 Merkmale des Erzählens untersuchen
1.5 Sprachliche Gestaltungsmittel untersuchen
2. Gedichte 2.1 Merkmale von Gedichten
2.2 Ballade siehe Vorjahre 2.3 Sonett siehe Vorjahr
3. Drama / Theater Begriffe siehe Vorjahre
4. Sachtexte siehe Vorjahre
5. Medien Zeitungen, journalistische Textsorten und Zeitschriften (vgl. Vorjahr)
6. Arbeitstechniken und Methoden siehe Vorjahre
7. Vortragen, Präsentieren, Interviews führen 7.1 Referate halten
7.2 Ein Interview führen Interviewleitfaden:
|